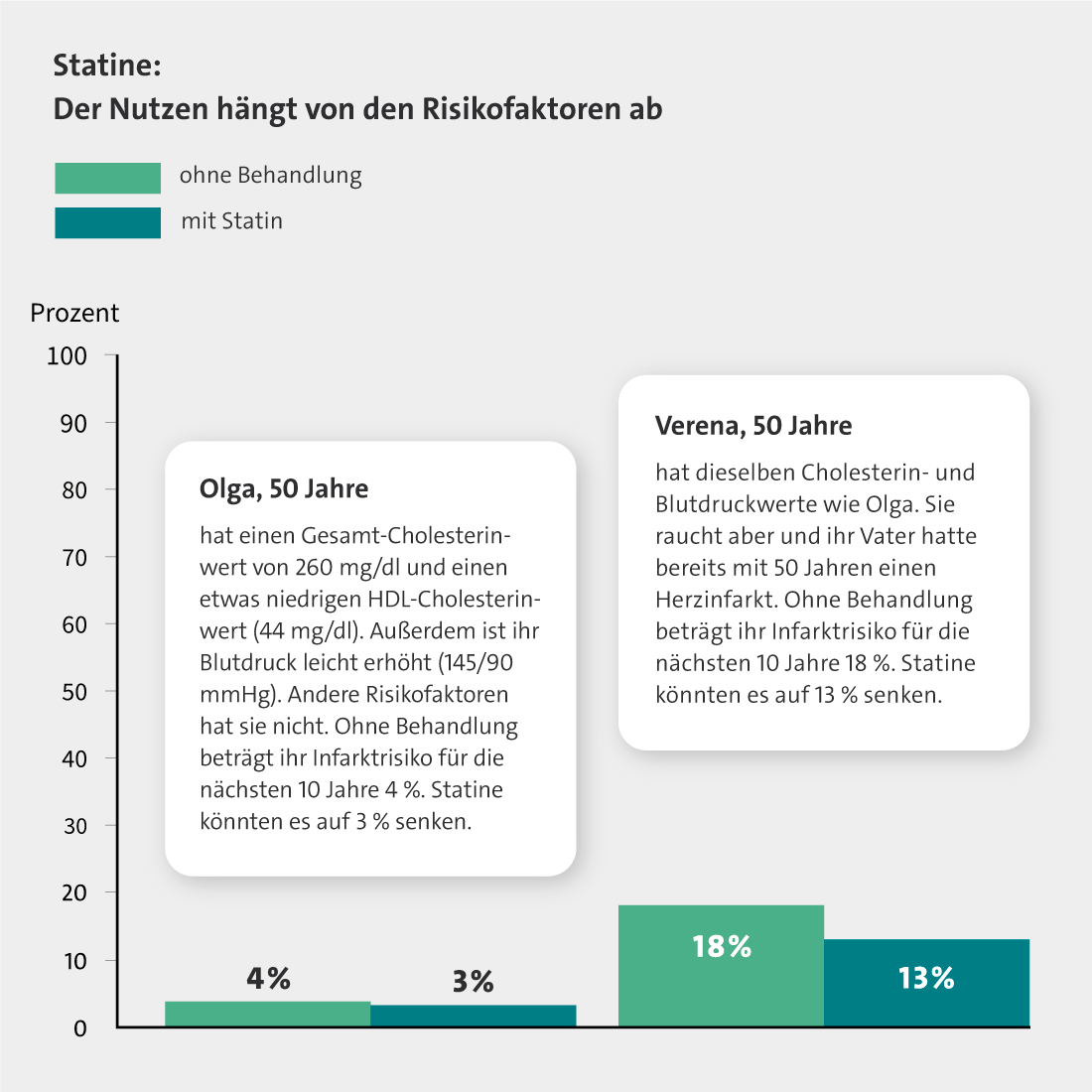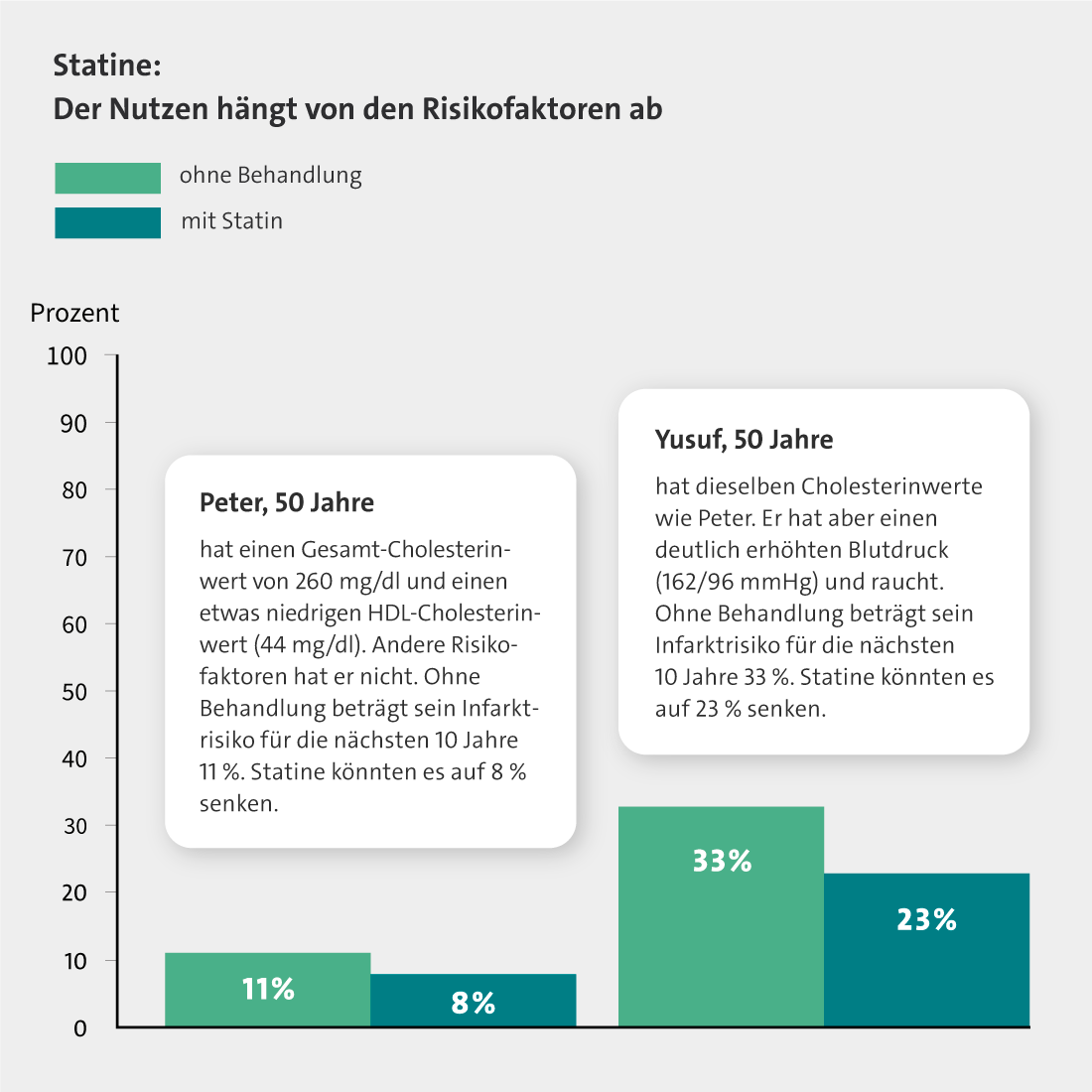Das Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen von Statinen ist sehr gering. Deshalb sind sich Fachleute einig, dass die Vorteile der Medikamente deutlich überwiegen.
Sehr selten führen Statine zu Muskelschäden. Sie äußern sich durch schmerzende, schwache und geschwollene Muskeln, typischerweise in den Schultern, Beinen oder im Rücken. Muskelschäden fallen auch in einer Blutuntersuchung auf, da die Menge des Enzyms Kreatinkinase im Blut steigt.
Die schwerste Form der Muskelschädigung ist die sogenannte Rhabdomyolyse. Dabei lösen sich Zellen der Skelettmuskulatur auf und gelangen in größeren Mengen ins Blut. Dadurch werden Abbaustoffe frei, die die Nieren schädigen können. Eine Rhabdomyolyse kann sich neben schmerzenden oder schnell ermüdenden Muskeln auch durch rötlich oder dunkel verfärbten Urin zeigen. Bei diesen Symptomen ist es daher wichtig, die Einnahme zu unterbrechen und umgehend ärztlichen Rat einzuholen.
In Studien traten Muskelschäden bei etwa 1 von 10.000 Menschen auf, die Statine über 1 Jahr einnahmen. Die schwere Form der Rhabdomyolyse war noch seltener. Das Risiko steigt, wenn Statine in hoher Dosierung eingesetzt werden.
Manche Menschen befürchten, dass sich mit der Zeit Wirkstoffreste im Körper ansammeln, wenn sie Medikamente über lange Zeit regelmäßig einnehmen. Solche Befürchtungen sind aber unbegründet: Der Körper verfügt über verschiedene Mechanismen, um Arzneistoffe laufend abzubauen und auszuscheiden.
Statine können mit bestimmten anderen Medikamenten wie etwa dem Antibiotikum Clarithromycin Wechselwirkungen haben. Daher dürfen sie nicht zusammen eingenommen werden. Um dies zu vermeiden, ist es sinnvoll, der Ärztin oder dem Arzt immer mitzuteilen, welche Medikamente man nimmt. Wer Statine nimmt, sollte außerdem auf Grapefruit verzichten: Die Frucht kann den Abbau des Medikaments in der Leber hemmen.