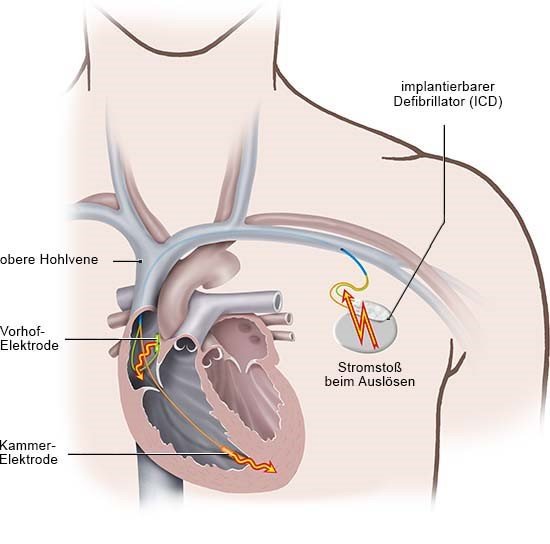Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: Executive Summary. Circulation 2018; 138(13): e210-e271.
Anderson RD, Ariyarathna N, Lee G et al. Catheter ablation versus medical therapy for treatment of ventricular tachycardia associated with structural heart disease: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and comparison with observational studies. Heart Rhythm 2019; 16(10): 1484-1491.
Clark AM, Dryden D, Hartling L. Systematic Review of Decision Tools and Their Suitability for Patient-Centered Decisionmaking Regarding Electronic Cardiac Devices (AHRQ Technology Assessment Program). 2012.
Claro JC, Candia R, Rada G et al. Amiodarone versus other pharmacological interventions for prevention of sudden cardiac death. Cochrane Database Syst Rev 2015; (12): CD008093.
Cronin EM, Bogun FM, Maury P et al. 2019 HRS/EHRA/APHRS/LAHRS expert consensus statement on catheter ablation of ventricular arrhythmias. Europace 2019; 21(8): 1143-1144.
Della Bella P, Baratto F, Vergara P et al. Does Timing of Ventricular Tachycardia Ablation Affect Prognosis in Patients With an Implantable Cardioverter Defibrillator? Results From the Multicenter Randomized PARTITA Trial. Circulation 2022; 145(25): 1829-1838.
Deneke T, Bosch R, Deisenhofer I et al. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zur Katheterablation ventrikulärer Arrhythmien. Kardiologe 2021; 15: 38-56.
Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons. Circulation 2008; 117(21): e350-408.
European Society of Cardiology (ESC), Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Eur Heart J 2015; 36(41): 2793-2867.
Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Europace 2022; 24(1): 71-164.
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Datengestütztes, zeitnahes Management in Zusammenarbeit mit einem ärztlichen telemedizinischen Zentrum bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz; Rapid Report: Auftrag N19-01. 2019.
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Telemonitoring mithilfe von aktiven kardialen implantierbaren Aggregaten bei ventrikulärer Tachyarrhythmie sowie Herzinsuffizienz; Abschlussbericht: Auftrag N16-02. 2018.
Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill; 2015.
Lima da Silva G, Nunes-Ferreira A, Cortez-Dias N et al. Radiofrequency catheter ablation of ventricular tachycardia in ischemic heart disease in light of current practice: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Interv Card Electrophysiol 2020; 59(3): 603-616.
Martinez BK, Baker WL, Konopka A et al. Systematic review and meta-analysis of catheter ablation of ventricular tachycardia in ischemic heart disease. Heart Rhythm 2020; 17(1): e206-e219.
Maskoun W, Saad M, Abualsuod A et al. Outcome of catheter ablation for ventricular tachycardia in patients with ischemic cardiomyopathy: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Int J Cardiol 2018; 267: 107-113.
Santangeli P, Muser D, Maeda S et al. Comparative effectiveness of antiarrhythmic drugs and catheter ablation for the prevention of recurrent ventricular tachycardia in patients with implantable cardioverter-defibrillators: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Heart Rhythm 2016; 13(7): 1552-1559.
Uhlig K, Balk EM, Earley A et al. Assessment on Implantable Defibrillators and the Evidence for Primary Prevention of Sudden Cardiac Death. (AHRQ Technology Assessment Program). 2013.
Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. 2022 [Epub ahead of print].
IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der Gesundheitsversorgung zu verstehen.
Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt geklärt werden. Gesundheitsinformation.de kann das Gespräch mit Fachleuten unterstützen, aber nicht ersetzen. Wir bieten keine individuelle Beratung.
Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Team aus Medizin, Wissenschaft und Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.